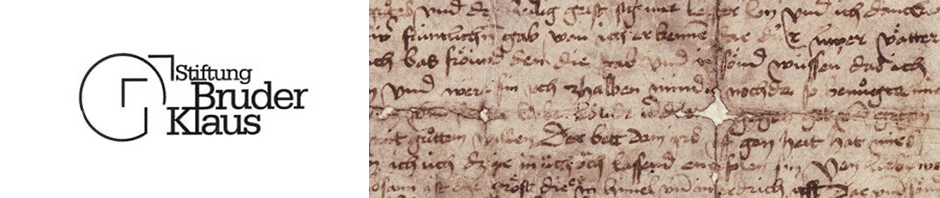Zum gegenwärtigen und zum geschichtlichen Kontext
Pfr. Dr. Paul Bernhard Rothen, Präsident der Stiftung Bruder Klaus
Europa befindet sich in einer geistigen Krise. Das klingt dramatisch. Aber gab es je eine Zeit, in der das anders war?
Spätestens seit Kaiser Konstantin die Bischöfe in die Mitverantwortung für sein Kaiserreich genommen hat, wurde das Ordnungsgefüge der europäischen Völker je wieder erschüttert von heftigen inneren Widersprüchen. Kann und will Christus für soziale Ruhe und Stabilität sorgen? Er hatte selber „nichts, wo er sein Haupt hinlegen“ konnte. Will er überhaupt Menschen hier in der Zeit zu einem wohl geordneten Leben verhelfen? Kann sich ein Gemeinwesen in dieser Welt behaupten, wenn es sich ernsthaft der Macht des Dornengekrönten unterstellt?
In der Flucht solcher Fragen drängt sich die Annahme auf, dass das Gefährliche an der gegenwärtigen Krise nicht diese Krise ist, sondern die Unfähigkeit, ihre tieferen Ursachen zu erkennen und zu benennen. Das zeigt sich besonders beklemmend an den Schwächen der Kirchen. Weder die Schultheologen noch die freikirchlichen Prediger finden Worte, die mit einer herausfordernden Schärfe in die aktuellen Debatten greifen, so dass die Zeitgenossen aufmerken, sich vielleicht ärgern – und sich nach einem pochenden Nachdenken an bislang unbekannten oder verdrängten Gesichtspunkten neu ausrichten könnten.
Innerkirchliche und theologische Herausforderungen
Vor zwei Jahren haben wir deshalb in einem kleinen Kreis von Pfarrkollegen mit der Arbeit an einem Bekenntnis begonnen. Das ist ja eine klassische Form, mit der die Kirchen auf verwirrende Entwicklungen ihrer Zeit zu reagieren versucht haben.
Wegleitend war zum einen die Überzeugung, dass die offenkundigen Schwächen der Kirchen primär nicht strukturell, sondern inhaltlich bedingt sind: Uns fehlt die Sprache, mit der wir die Entwicklungen der Zeit vollmächtig deuten und dem Evangelium in einer breiteren Öffentlichkeit Aufmerksamkeit schaffen könnten. Die Hoffnung Dietrich Bonhoeffers, dass uns eine solche ganz neue Sprache geschenkt werde, hat sich bislang nicht erfüllt.
Unsere Vermutung war: Das liegt auch daran, dass wir Theologen am falschen Ort suchen. Die Ermutigung für uns und unsere Gemeinden suchen wir in attraktiveren Angeboten, in der Begeisterung gelungener Aktionen und vor allem in einer grösseren persönlichen Überzeugungskraft – nicht aber dort, wo die Erneuerung der Kirche je wieder ihren Anfang genommen hat, bei den Worten der Propheten und Apostel.
Zum andern meinten wir beunruhigt feststellen zu müssen, dass der offensichtliche Zerfall der Kirchen nicht eine innerkirchliche Bescheidenheit und das Ringen um ein neues, möglichst realitätsnahes Verstehen fördert, sondern im Gegenteil eine bequeme Resignation: Unter dem weiten Dach einer Kirche, die für alle und alles offen sein will, kann gar nicht inhaltlich präzise gefragt und um die treffenden Antworten gestritten werden. Vielmehr bauen sich Ämter und Behörden zu Autoritäten auf, die im Interesse der kirchlichen Selbstprofilierung zum Zweck einer grösseren sozialen Schlagkraft loyale Unterordnung einfordern, wie man das bisher nur von der römisch-katholischen und von Freikirchen kannte. Der Druck nimmt zu, sich einzufügen in das Mittelmass von „optimistisch zuversichtlichen“ Selbstdarstellungen. Wo jemand eine theologische Überzeugung pointiert durchzuhalten und hörbar zur Sprache zu bringen versucht, wird ihm unterstellt, das diene nur seiner persönlichen Geltungssucht. Zielbewusst arbeiten die kirchlichen Fachstellen darauf hin, dass zukünftig nur noch weich gespülte Teamworker einen Platz in den Kirchen finden. Die akademischen Schultheologen haben diesem Bestreben nichts entgegenzusetzen.
In dieser Situation kann ein Bekenntnis ein Mittel sein, um die inhaltlichen Fragen neu aufzuwerfen, bevor sie heillos verbandelt mit persönlichen Konflikten aufbrechen. Indem ein solches Bekenntnis nach dem Vorbild der Alten das Evangelium mit bejahenden und mit abgrenzenden Sätzen zur Sprache bringt, kann es gegen innen und aussen klar machen, dass sich die Wahrheit des Glaubens von Anfang an ihren schmalen Weg zwischen stückweisem Verstehen, verständlichen Missverständnissen und böswilligen Umdeutungen suchen muss.
Indem es an das erinnert, was frühere Generationen zu erkennen und festzuhalten versucht haben, hilft es, in der Hitze der Alltagsmühe die grösseren Horizonte präsent zu halten, so dass kleine Gegensätze nicht unnötig hochgeschaukelt werden. Ganz praktisch kann es dazu beitragen, die Diskussionen in kirchlichen Gremien vom allzu Persönlichen wegzunehmen, und allen Beteiligten eine reale Chance geben, Konflikte gutwillig durchzustehen, also mit Respekt vor der theologischen Sachkenntnis und entsprechenden Gewissensbindungen.
Im Moment scheint noch immer der Kampf gegen die Subjektivismen der Moderne (und Postmoderne) die drängendste und schwierigste Aufgabe zu sein. Die romantische, an einer abstrakt verallgemeinerten Vorstellung vom „Religiösen“ orientierte neuprotestantische Theologie, wie sie wegweisend von Friedrich Schleiermacher (1768-1834) vertreten worden ist, ist an den deutschsprachigen theologischen Fakultäten fast alleinherrschend. Sie steht paradigmatisch für die überspannten Begriffsbildungen, die es schwer machen, zwischen der Substanz des Gotteswortes und den je ganz subjektiven Ahnungen und Ideen zu unterscheiden.
Wenn aber dieser Subjektivismus in Frage gestellt werden soll, kann das nicht auf einer subjektiv gewählten Grundlage geschehen. Deshalb haben wir uns den Duktus und die Hauptaussagen für das Bekenntnis vorgeben lassen von einem Text, der zweifellos – sperrig dicht – im Herzen der Geschichte Europas steht: Der Brief, den Bruder Klaus am 4. Dezember 1482 an die Berner Ratsherren gerichtet hat.
Ein Wort aus einer Zeit grundlegender Klärungen
Dieser Brief erwächst aus einer langen Tradition von geistlichen Mahnschreiben an die Mächtigen der Zeit. Er verdichtet die Erkenntnisse, die aus der Christusnachfolge in der spätmittelalterlichen Frömmigkeitsbewegung geflossen sind. Und er bricht sich seine Bahn aus der verwunderten Dankbarkeit darüber, dass ein heftiger politischer Konflikt ausnahmsweise nicht durch die Macht von Waffen und Geld, sondern durch die Bereitschaft auf einen Rechtsverzicht überwunden werden konnte. Im Gehorsam gegen den Ruf des Evangeliums hatte sich Bruder Klaus von seiner Heimat losgerissen und durfte dann erleben, wie sein Friedenswort in die Streitigkeiten seiner Heimat ein Licht aus einer anderen Welt trug.
Nach dem militärischen Triumph über Karl den Kühnen von Burgund war die junge Eidgenossenschaft in einen tiefen, im Grunde unlösbaren Konflikt geraten. Die Stadt- und die Landorte hatten je ihre guten Gründe, wie das Bündnisgefüge neu zu ordnen sei. Zwei Jahre lang war der Einsiedler im Ranft in die Verhandlungen einbezogen und versuchte zwischen vernünftigen Ansprüchen, höchst realen Ängsten, handfesten Interessen, dummdreist grossmauligen Drohungen, persönlichen Kränkungen und viel anderem mehr einen tragfähigen Frieden zu vermitteln. Nachdem dieses Bemühen in dramatischen Stunden vor dem Scheitern bewahrt und das neue Bündnisgefüge beschworen werden konnte, hielt das Tagsatzungsprotokoll vom 22.Dezember 1481 ausdrücklich fest, damit könne man „heimbringen die Treu, Mühe und Arbeit, so der fromme Mann Bruder Klaus in diesen Dingen getan hat“. Bruder Klaus hatte die Grundlagen gelegt für das eidgenössische Gemeinwesen, das im Herzen Europas wachsen, Bestand haben und nach den napoleonischen Direktiven zu seiner modernen, heute noch lebensfähigen Form finden konnte.
Die Berner Ratsherren lohnten diesen Einsatz mit einer grossen Zuwendung an die Stiftspfründe, und Bruder Klaus dankte ihnen diese Dankesgabe mit dem kurzen Brief, in dem er – das einzige Mal in seinem Leben – sein knappes, von einer bebenden Liebe erfülltes Predigtwort an sie richtete.
Den Worten dieses Briefes, der sich einem wegweisenden Augenblick in der europäischen Geschichte verdankt, folgt das Bekenntnis, das in der gegenwärtigen Krise zu notwendigen Klärungen verhelfen und die Gewissheit und den Mut zum Einsatz stärken möchte.